„[…] ‚Darf‘ ein Autor eine Identität inszenieren, um seine Bücher an den Mann zu bringen? Darf der Roman also auf das Leben des Autors übergreifen bzw umgekehrt, darf man sich selbst zur Romanfigur machen, die man dann ein Buch schreiben lässt? […]“ Juli Zeh am 4. Juni auf Facebook
Diese Fragen stellte Juli Zeh als Reaktion auf einen schon etwas zurückliegenden Artikel des „Buecherbloggers“, in dem sich selbiger über die Fiktionalität einer Autorinnenidentität brüskiert. Aber der Reihe nach.
Hätte nicht ausgerechnet Juli Zeh diese Frage gestellt, ich hätte sie aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Kopfschütteln abgetan und als engstirnig oder spießbürgerlich angesehen. ((Sie selbst weist in einem späteren Kommentar darauf hin, dass die Frage nicht so sehr normativ zu verstehen sei, sondern auf die gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Täuschung abziele. In der Folge entbrennt eine Diskussion, in die sich schließlich Aléa Torik selbst einklinkt, die/der dafür eigens einen Facebook-Account eingerichtet hat. Auf den genauen Diskussionsverlauf kann hier nicht näher eingegangen werden, sie diente lediglich als Anregung für die vorliegende Auseinandersetzung mit dem Thema.)) So aber sah ich mich gezwungen, mich von meiner etwas oberflächlichen Betrachtungsweise zu verabschieden und mich etwas in die Materie einzuarbeiten.
Prämisse
Eines vorweg: Ich habe weder den Roman jener fiktiven Autorin selbst gelesen, noch habe ich ihren Blog vor der Recherche für diesen Artikel verfolgt. Ich kann und ich will keinesfalls beurteilen, welchen literarischen Wert oder welche Qualität der Roman aufweist. Worum es vielmehr gehen soll, ist die fiktive Autorin und deren ebenso fiktive Biographie.
Der Sachverhalt
Aléa Torik wurde 1983 in Rumänien geboren, wuchs zweisprachig auf, studierte Linguistik und Literaturwissenschaft in Bukarest und Berlin und debütierte mit ihrem Roman „Das Geräusch des Werdens„. ((So liest man es etwa noch auf LitBlogs.net. Der Verlag hat die Informationen zur Autorin auf seiner Homepage inzwischen um ihre Fiktionalität ergänzt.)) Das alles hat nur einen Haken: Nichts davon ist real — abgesehen vom Roman selbst. Die Autorin samt Biographie ist eine Fiktion, ersonnen von einem gewissermaßen zuvor „erfolglosen“ männlichen Autoren und gestützt durch einen Blog, den dieser unter dem Namen der vermeintlichen Autorin führte. ((Wo hier nun der Skandal sein soll, erschließt sich mir nicht ganz, gilt es doch vielen als vielleicht beste Eigenschaft des Internets, dort in der fast vollkommenen Anonymität in eine gänzlich anderen Rolle schlüpfen zu können. Einen Blog als Beleg für die reale Existenz einer Person heranzuziehen, zeugt in meinen Augen nicht gerade von einem tieferen Verständnis des Mediums…))
Rauschen im (digitalen) Blätterwald
Die Angelegenheit ist inzwischen auch schon wieder eine Weile her — der Roman erschien bereits im Frühjahr 2012 — und inzwischen haben sich vor allem Blogger mit dem Fall auseinander gesetzt. Kaum jemand hat sich dabei auf so hohem Niveau ereifert, wie der „Buecherblogger“ dies unter anderem hier, hier oder hier getan hat. Und nicht nur er fühlt sich als Leser getäuscht und an der Nase herumgeführt.
Der Fall „Aléa Torik“ hat es inzwischen auch ins Fernsehen geschafft: In der Sendung „Bauerfeind“ vom 15. April 2013, zu finden in der 3sat-Mediathek, wurde die Thematik aufgegriffen und der tatsächliche Autor Claus Heck, gewissermaßen der Schöpfer von Aléa Torik, vorgestellt und seine Beweggründe beleuchtet. Die ganze Sache zieht also noch immer ihre Kreise.
Erfundene Autoren — ein literaturhistorischer Abriss
Dabei ist die Sachlage gar nicht mal so sonderlich neu. Mir fallen sogar eine ganze Reihe zwar nicht exakt gleich aber doch ähnlich gelagerter Fälle ein, die mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. ((Die Fälle, in denen es nur um das Schreiben unter Pseudonym geht, fallen aus dieser Betrachtung weitgehend heraus, da sie dem Sachverhalt in seiner Gänze nicht gerecht werden. Einen Überblick zur Verwendung von Synonymen findet man etwa bei Rainer Schmitz: Was geschah mit Schillers Schädel?, Frankfurt am Main 2006, Sp. 1140-1156.)) Das Phänomen zugeschriebener Autorschaft reicht sogar zurück über die Renaissance ((Lange hat man ja auch über die Urheberschaft der Werke Shakespeares debattiert.)) und das Mittelalter bis in die Antike hinein. ((Die klassische Philologie kennt etwa die „Homerische Frage“ danach, ob die Epen überhaupt von einem Autoren allein verfasst wurden, oder ob unter dem Namen gewissermaßen ein Autorenkollektiv verstanden werden muss.))
Ich beschränke mich auf die letzten Jahrhunderte — ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da wäre zum einen der „Ossian“ des Schotten Macpherson, der unter diesem Namen ein altgälisches Heldenepos ersonnen hat in dem die einen zu gerne ein schottisches Nationalepos sehen wollten, während andere dahinter schon bald die Täuschung vermuteten. ((Auch in Deutschland wurde der „Ossian“ rezipiert und fand selbst wiederum Eingang in die Literatur: Goethes Werther etwa gibt sich der Lektüre hin und stellt ihn sogar über Homer; siehe Brief vom 12. Oktober.)) Hinzu kommen die „Nachtwachen Bonaventuras„, über deren Autorschaft bis in die 1980er Jahre hinein debattiert wurde und hinter der man unter anderem auch Clemens Brentano und E.T.A. Hoffmann vermutete, was sicherlich auch Einfluss auf die Rezeptionshaltung hatte.
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war sogar die umgekehrte Genderzuschreibung gang und gäbe, da sich Autorinnen eines männlichen Pseudonyms bedienten, um ihre Manuskripte veröffentlichen zu können. ((Chralotte Brontë, die unter dem Namen Currer Bell veröffentlichte, wäre hier zu nennen, oder auch Mary Ann Evans, die besser unter dem Namen George Eliot bekannt ist.)) Diese Pseudandronyme sind im Vergleich zu den Pseudogynymen wie es im Fall „Aléa Torik“ vorliegt, deutlich seltener, doch auch hierfür lassen sich Beispiele finden: Prosper Mérimée bediente sich etwa auch des Pseudonyms Clara Gazul. ((Vgl. „Pseudonym“, in: Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 82001, S. 647f.)) Auch wenn mit der Verwendung eines Pseudonyms nicht zwangsweise eine fiktive Rollenbiographie verknüpft sein muss, evoziert der Name doch eine Geschlechterzuschreibung.
Ferner ist natürlich Karl May zu nennen, der zwar nicht unter einem Pseudonym schrieb, allerdings die Selbstinszenierung in der Heldenrolle seiner Abenteuerromane als marketingstrategischen Vorteil erkannt und genutzt hatte — ganz zu schweigen davon, dass er die Länder und Landschaften, die er in seinen Büchern beschrieb, selbst nie bereist hatte. Dass man seine (Auto-)Biographie etwas „lebhafter“ gestaltete, als sie tatsächlich war, kam unter Schriftstellern aber durchaus häufiger vor, wie noch zu zeigen sein wird.
Daneben gibt es Bücher, die von ganz offenkundig fiktiven Autoren geschrieben wurden. Etwa „God Hates Us All“, „a wry literary masterpiece“, verfasst von einem gewissen Hank Moody, der seinerseits von David Duchovny in der Showtime-Serie „Californication“ verkörpert wird und aus der auch das vorige Zitat aus dem Klappentext entstammt. In diese Kategorie fallen auch „Der Bro-Code“ und „Das Playbook“ von Barney Stinson, einem Charakter aus der Serie „How I Met Your Mother“, zu dessen Name wenigstens auch der des „Co-Autors“ auf dem Cover genannt wird. Die fiktionale Existenz des Autors wird so gewissermaßen auf die Realität ausgeweitet, sie reicht aus dem an sich geschlossenen Kontext einer TV-Serie heraus. Dabei geht es natürlich um die Vermarktbarkeit des Buches, aber auch um die Vermarktung des Produktes dahinter, womit diese Art fiktionaler Autorschaft eher als erweitertes Merchandising zu verstehen ist.
Die „Täuschung“ kann im Literaturbetrieb also durchaus auf eine gewisse Tradition zurückblicken. Auch gab es Fälle, die noch enger mit dem hier betrachteten verwandt sind: Ern Malley war australischer Dichter, der 1918 in Großbritannien geboren worden war und noch in Kindertagen zusammen mit seiner Familie nach Australien auswanderte, wo er als Versicherungskaufmann tätig war und nebenher Gedichte verfasste, die nach seinem Tod von seiner Schwester entdeckt wurden — und er war, ebenso wie seine Schwester und die gesamte Familie, weiter nichts als Fiktion, in Wahrheit ersonnen von den jungen Dichtern James McAuley und Harold Stewart, die den gewissermaßen posthum veröffentlichten Gedichtband an einem Nachmittag regelrecht „zusammenwürfelten“. Der Fall flog schließlich auf, erfuhr einiges Medienecho, blieb in seinen Folgen aber eher überschaubar. ((Dokumentiert ist der Fall etwa auf der offiziellen Homepage ernmalley.com.))
Gerade in den letzten Jahrzehnten gab es dann noch einige solcher „Literary Hoaxes„, die ein gewisses Skandalpotential aufwiesen: In Belgien gab es den 1997 erschienen, vermeintlich autobiographischen Bestseller „Survivre avec les Loups“ von Misha Defonseca, in dem sie ihre Geschichte als Holocaust-Überlebende schildert; 2007 wurde der Roman verfilmt, kurz darauf räumte die Autorin ein, dass die Geschichte frei erfunden sei — sie ist nicht einmal von jüdischer Abstammung. ((Henryk M. Broder berichtete im „Spiegel“ bereits im Dezember 1996 über die gerade zu Literatur gewordene aber noch nicht erschienene Lebensgeschichte und scheint auch schon damals ein wenig Lunte gerochen zu haben, wenn er konstatiert, dass, wer bei dieser Geschichte an „Shoa-Business“ denke, „mit seinem Verdacht vermutlich nicht völlig daneben“ liege.)) Vornehmlich in Australien sorgte der Fall „Norma Khouri“ für einiges Aufsehen, deren 2003 erschienenes Buch „Honor Lost“ über Ehrenmord sich ein Jahr später als nicht wahrheitsgemäß herausstellte. ((Ihr Fall wurde 2007 unter dem Titel „Forbidden Lie$“ (sic!) verfilmt.)) In den USA gab es 2006 eine Kontroverse um James Frey, nachdem aufgedeckt wurde, dass seine autobiographischen Romane „A Million Little Pieces“ (2003) und „My Friend Leonard“ (2005) über Drogen- und Alkoholabhängigkeit keinen realen biographischen Hintergrund hatten. Auch in Deutschland gab es ähnliche Fälle in den letzten Jahren. Ich erinnere etwa an die Kontroverse um das 2004 erschienene „Feuerherz“ der Autorin Senait Mehari, deren Vergangenheit als Kindersoldatin öffentlich angezweifelt wurde. ((Berichte des NDR-Medienmagazins ZAPP finden sich noch auf YouTube oder auf der Homepage des NDR.)) Oder an Ulla Ackermanns Autobiographie „Mitten in Afrika – Zuhause zwischen Paradies und Hölle“ von 2003, die mehrere Wochen auf den Bestsellerlisten zu finden war, bevor sie als unwahr enttarnt wurde. 2008 gab es in den USA den Fall von Margaret B. Jones, die in ihrer fiktiven Autobiographie „Love and Consequences“ von ihrer angeblichen Vergangenheit im Gang-Milieu der „Bloods“ berichtete und schließlich aufgrund ihrer Schwester aufflog.
Und dann gab es da, ebenfalls 2008, diesen Fall in den USA, vor dessen Hintergrund die Erschaffung einer „Aléa Torik“ geradezu wie eine müde Kopie, wie ein billiger Abklatsch erscheinen muss, da jener aufgrund der abgehandelten Thematik und des gesamten Ausmaßes der Täuschung eine deutlich größere Brisanz entfaltete. JT LeRoy, 1980 in West Virginia geboren, durchlebte eine Zeit der Prostituion, der Drogenabhängigkeit und der Landstreicherei, die ihren Tribut in Form einer HIV-Infektion forderte, und verarbeitete seine Erfahrungen schließlich, indem er darüber in autobiographisch angehauchten Romanen schrieb — oder eben auch nicht. So stellte sich nach mehreren Jahren erfolgreicher Täuschung heraus, dass es einen JT LeRoy nie gegeben hat, dieser vielmehr von einer gewissen Laura Albert ersonnen worden war, die auch die Interviews und öffentlichen Auftritte, inszenierte; ein weiterer Clou bestand darin, dass LeRoy bei öffentlichen Auftritten von deren mit Perücke und Sonnenbrille ausgestatteten Schwägerin Savannah gespielt wurde. Der Fall verursachte einiges Aufsehen, ((Stellvertretend für andere Berichte sei an dieser Stelle auf jenen in der New York Times verwiesen, die im Oktober 2005 den Schwindel auffliegen ließ.)) nicht zuletzt weil JT LeRoy die Herzen so manches Hollywoodstars erobert hatte. Asia Argento verfilmte sogar den zweiten Roman LeRoys, „The Heart is Deceitful Above All Things“, ohne zu wissen, dass der vermeintliche autobiographische Roman gar nicht so autobiographisch ist. Man kann sich vorstellen, dass nicht nur die Promis von dieser Wende, gelinde gesagt, wenig begeistert waren… Ein kleines Körnchen Wahrheit könnte am Ende aber dennoch darin stecken: Im Rahmen eines Beitrages der arte-Sendung „Tracks“ vom 7. März 2008, ((Ein Video der deutschen Fassung des Beitrages konnte ich nicht auftreiben, das der französischen findet man allerdings auf YouTube.)) beschreibt sie die Figur als eine Art „Alter Ego“, derer sie sich bediente, um ihren eigenen Missbrauch als Kind zu verarbeiten und die schließlich ein Eigenleben entwickelte und sich gewissermaßen als multiple Persönlichkeitsstörung manifestierte.
Gerade die Beispiele aus jüngster Zeit zielen eindeutig darauf ab, die eigene Persönlichkeit für das Publikum interessanter zu machen. Man schreckt nicht davor zurück, sich als Junkie zu inszenieren, um Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Mitleid, zu erregen. Doch noch einmal zurück zu Aléa Torik, deren Rollenzuschreibung vor dem Hintergrund falscher Holocaust-Biographien und abgefuckter Junkie-Existenzen geradezu harmlos scheinen muss.
Von der Notwendigkeit, eine Frau zu sein…
Verhält sich der Sachverhalt tatsächlich so, wie der „Bauerfeind“-Beitrag es darstellt, und der Autor ist zuvor mit seiner richtigen Identität bei mehreren Verlagen abgeblitzt, zeigt diese Angelegenheit in der Tat einmal mehr die Oberflächlichkeit des deutschen Literaturbetriebes auf, der sich in der Tat mehr für die Biographien ihrer Autoren als für die Literatur selbst zu interessieren scheint. ((Was war das doch damals, anno 2010, für ein Skandal mit diesem Plagiat der Helene Hegemann. Man hätte das alles doch so gerne glauben wollen in den Feuilletons…!)) Für die Verbreitung auf dem Literaturmarkt und die Befriedigung einer von den Verlagen angenommenen Erwartungshaltung des Publikums, scheint es tatsächlich angeraten zu sein, sich als weiblichen Genius zu verkaufen. Mit der Kreation des Typus einer jungen, weiblichen Autorin, am besten noch als „Stimme ihrer Generation“ in den Himmel gehoben, wie in diesem Fall auch gerne mit Migrationshintergrund, geht die Erschaffung einer Erwartungshaltung einher, direkt in deren Vorstellungs- und Gedankenwelt eintauchen zu können. Die Verlage geizen dahingehend zumeist auch nicht mit Hinweisen auf die „Authentizität“ des Geschriebenen. Dabei müsste doch eigentlich klar sein, dass nicht einmal bei realen Personen, die diesem Typus entsprechen, davon ausgegangen werden kann, dass ihre Schilderungen etwas anderes als Fiktion seien. Und vielleicht bin ich dahingehend etwas naiv, doch scheint mir der Intellekt, der zum Verfassen eines auch nur halbwegs lesenswerten Romans vonnöten ist, die von manchem Leser erwarteten sexuellen Eskapaden sodomistischer Verderbtheit von vornherein weitgehend auszuschließen.
Authentisch ≠ autobiographisch
Die Konzeption als pure Werbestrategie abzutun, wie dies an verschiedener Stelle im Laufe der Diskussion getan wurde, greift für mich aber zu kurz. Warum dies aber trotzdem kein Betrug am Leser sein sollte? Weil die so suggerierte Authentizität keineswegs die Authentizität eines Autors per se ist. Oder, um es anders auszudrücken, weil Authentizität nicht mit Autobiographie gleichzusetzen ist. Ein Autor erschafft Fiktionen. Dass er die Realität dabei in größerem oder kleineren Maße einfließen lässt, ist klar. ((Sogar Fantasy- und Science-Fiction-Literatur muss ja — und sei es nur hinsichtlich der Interaktion zwischen Figuren — gewissermaßen aus der Realität gespeist werden.)) Was für ihn aber „Authentizität“ ausmacht, so meine These, ist weniger der Anteil an Realität im Erzählten, als vielmehr der Anteil des Autors in seinem Text in Form seiner Ideologie, seiner Weltanschauung oder wie auch immer man den Impetus nennen will, der ihn zum Schreiben antreibt. Zu welchem Mittel dieser letzten Endes greift, um seinen Text auf den Markt zu bringen und diesen vielleicht auch ein bisschen aufzurütteln, hängt dann aber weniger von seiner Authentizität als vielmehr von seiner Aufrichtigkeit (auch dem Leser gegenüber) ab.
Kein Vergehen, ein Verdienst!
Natürlich muss sich Kunst, jedenfalls dort, wo man sie als frei von äußeren Zwängen ansehen will, keinen normativen Werten unterordnen. Werden diese Werte dann durch sie in Frage gestellt, werden mit ihr Grenzen überschritten, so folgt daraus der Skandal. Und was wäre die Kunst ohne Skandale? Das Verdienst des Autors hinter der künstlichen Identität liegt meines Erachtens darin, dass er den Leser — jedenfalls nachdem die artifizielle Identität aufgeflogen ist und unabhängig davon, ob dieser Effekt beabsichtigt war — zur Reflexion zwingt, indem er ein Prinzip in Frage stellt, das heute nur allzu gerne als Maßstab angelegt wird: Wie viel von dem, was in dem Buch steht, ist „echt“? ((Eine Frage, die man sogar bei Büchern stellen sollte, die namentlich als Autobiographie ausgewiesen sind. Man denke nur an Goethes apotheotisches „Dichtung und Wahrheit“.)) Die Frage nach der Korrelation mit der Autobiographie des Autors hört man des Öfteren bei Lesungen, manchmal hört oder liest man sie auch in Interviews. Das Spiel mit der damit verbundenen Erwartungshaltung ist ebenfalls nicht neu. Charlotte Roche, die ich in diesem Zusammenhang keinesfalls als Beispiel für schöngeistige Literatur heranziehen möchte, deren Fall aber noch recht gut im kollektiven Gedächtnis verankert sein dürfte, hat diese Finte als Werbestrategie eine erhebliche Zahl zusätzliche Leser beschert. Dass sich der Leser dabei an der Nase herumgeführt fühlen darf, räumte Roche etwa in einem Interview mit dem ZEITmagazin ein. Die Erschaffung einer „Aléa Torik“ geht lediglich noch einen Schritt weiter, indem sie die autobiographischen Bezüge gewissermaßen ins Leere — oder zumindest ins Opake einer erfundenen Biographie — laufen lässt.
Fazit
Dass Erkenntnis auch mal schmerzlich sein kann, manchmal sogar schmerzlich sein muss, ist nichts neues. Es ist nicht verwerflich, einem solchen „Betrug“ (so man es denn als solchen wahrnimmt) aufgesessen zu sein, solange man eine Lehre daraus zieht. Und wenn man sich das nächste Mal dabei ertappt, über den autobiographischen Hintergrund eines fiktiven Textes zu spekulieren, sollte man sich vielleicht fragen, wann man eigentlich im Radio zuletzt von einer Alieninvasion gehört hat…
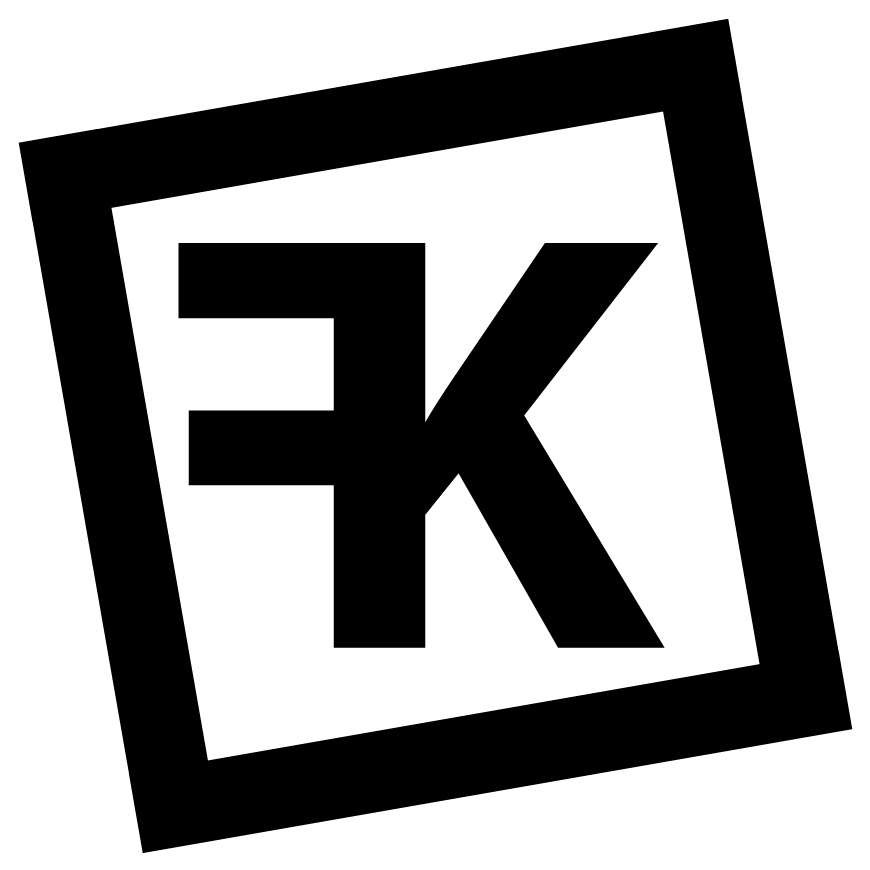
0 Kommentare
2 Pingbacks